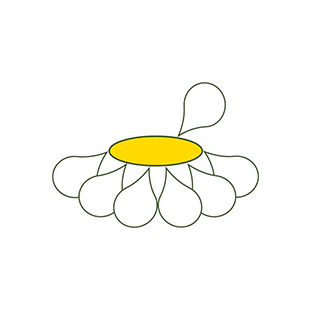Benediktenkraut (Cnicus benedictus)
Kraut und Wurzeln des Benediktenkrautes gehören zu den klassischen Amarum-Aromatika, den Bitterstoffen. Ihr Bitterwert wird mit 1:1800 angegeben (Fintelmann). Wie schon der Name andeutet, zählt das Benediktenkraut zu den klassischen Vertretern der Klostermedizin. Ursprünglich stammt es aus der Mittelmeerregion und wird in unseren Breiten vorzugsweise als Kräuterdroge angebaut. Ausgewilderte Formen finden sich auf mageren und trockenen Böden.
Ein Appetitanregendes Kraut
Angeblich sollen bittere Kräuter die Herzen froh machen. Ob diese Erkenntnis mit der traditionellen Verwendung des Benediktenkrautes als Zutat für Magenliköre zusammenhängt, bleibt offen. Bekanntermassen regen die Bitterstoffe die Speichel- und Magensaftproduktion an. Die folgende körpereigene Reaktion darauf ist meist ein gesteigerter Appetit. Mit dem vermehrten Ausstoss von Verdauungssäften verbessert sich auch die Verarbeitung der aufgenommenen Nahrung.
Die Wirkung von Benediktenkraut (Cnici benedicti herba) wurde durch die Kommision E des BfArM bei Appetitlosigkeit und dyspeptischen Beschwerden anerkannt. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA/HMPC hat die Monografie Benediktenkraut (Cnicus benedictus L., herba) zu Beginn des Jahres 2024 veröffentlicht.
Wie schon der Name Benediktenkraut sagt, befinden sich die meisten Inhaltsstoffe in den Blättern und Blüten, weniger in den Stengeln. Der ideale Erntezeitraum ist während der Blüte im Hochsommer. Sein Blätter ähneln denen von Distel. Tatsächlich wird botanisch das Benediktenkraut den Korbblütlern zugeordnet.
Wirkungsvolle Bitterstoffe für den Bauch
Wie zu erwarten wurde die Zuerkennung als traditionelles pflanzliches Heilmittel dem Benediktenkraut für zwei altbekannte Indikationen erteilt. Kräutertee-Zubereitungen aus den Blättern (Cnicus benedictus L., herba) können bei Appetitsverlust helfen. Ebenso kann es bei dyspeptischen Beschwerden wie Krämpfen im Oberbauch zur Linderung der Symptome verwendet werden. Als dyspepitsche Beschwerden wird ein Symptomkomplex beschrieben, der Oberbauchbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Aufstossen, Sodbrennen und vorzeitiges Sättigungsgefühl umfasst.
Inhaltsstoffe:
Sesquiterpenlactone, Lignanlactone, pentazyklische Triterpene, Phytosterole, Flavonoide, Kalium- und Magnesiumsalze, wenig ätherisches Öl
Wirkung:
antimikrobiell, verdauungsfördernd, appetitanregend, entzündungshemmend
Gegenanzeigen:
Anwendungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter unter 18 Jahren werden nicht empfohlen!
Allergiker mit Empfindlichkeit auf Korbblüher sollten bei der Verwendung von Benediktenkraut Vorsicht walten lassen!
Sollten die Symptome unter Einnahme sich nicht verbessern oder sogar verschlechtern, ist ärztlicher Rat erforderlich.