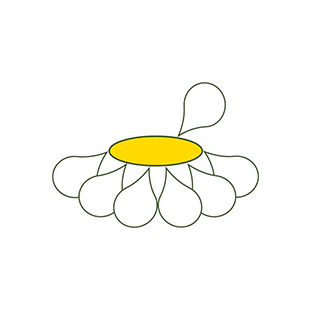Berg-Wundklee (Anthyllis montana)
Der Wundklee kommt mit einfachsten Böden zurecht. Als Tiefwurzler holt er sich die Nährstoffe und das Wasser aus tieferen Erdschichten. Daher wird er gerne für die Befestigung von lockeren Gestein und kargen Wiesen genutzt.
Was der Ursprung für die Bezeichnung als Zauber- oder Schreikraut sein könnte, ist schwer zu sagen. Es soll über Kinderbetten aufgehängt vor bösen Geistern schützen, die Kleinkinder erschrecken und zum Schreien bringen können.
Vielleicht umschreibt die Bezeichnung Schreikraut auch die volkstümliche Verwendung des Wundklees bei Husten und Katarrhen. Wenn diese ausgestanden sind, klappt es auch wieder mit dem Schreien. Hierfür wurde das Kraut mit Blüten in kochendem Wasser aufgebrüht, was innerlich angewendet wurde.
Zur Heilung von Wunden und Geschwüren wurde die Blüten des Wundklees zur äusserlichen Anwendung für Umschläge aufgekocht. In Wasser gekochter Wundklee wurde auch zur Förderung der Wundheilung getrunken.
Inhaltsstoffe:
Saponine, Gerbstoffe
Wirkung:
adstringierend,
Die Wirkung des Wundklees wurde bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Eine Monografie wurde weder von der Kommission E noch von der EMA/HMPC veröffentlicht.