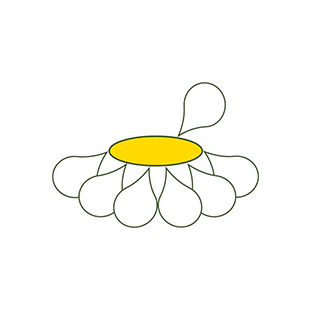Wahrer Bärenklau (Acanthus mollis)
Besser bekannt ist die in Gärten beliebte Schmuckpflanze unter dem Namen Weiche Bärentatze. Wieso sich der Name Bärenklau eingeprägt hat, lässt sich nicht nachvollziehen. Der hierzulande wohlbekannte und wegen der Hautreizungen verursachende gefürchtete Bärenklau (Heracleum) hat mit dem hier besprochenen Akanthusgewächs nichts gemein. Sicher ist, ursprünglich stammt die Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Bereits in den Aufzeichnungen des Diskourides wurde sie mit heilenden Kräften bei Wunden und Verrenkungen vermerkt. In vergangenen Zeiten gehörte die Wurzeln und Blätter des Wahren Bärenklaus zum Standardrepertoire jeder Apotheke. Bei Brandwunden und Geschwülsten wurde er zur Erweichung des Gewebes eingesetzt, wahrscheinlich um die Bildung von Narbengewebe zu reduzieren.
Weitere Quellen beschreiben die Wirkung von Acanthus bei Erkrankungen der Atemwege, Beschwerden im Verdauungstrakt sowie bei Erkrankungen der Haut.
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist die Weiche Bärentatze aus dem Fokus der Pflanzenmedizin verschwunden. Weder die ESCOP, noch die Kommission E oder die EMA/HMPC haben eine Monografie zum Wahren Bärenklau (Acanthus mollis) veröffentlicht.
Rätselhaft und spektakulär in ihrer Gestalt ist die wunderschöne Pflanze aus dem Mittelmeerraum nicht nur für Gärtner und Pflanzenliebhaber. Die Form der Blätter des Acanthus mollis inspirierten wohl Architekten vom Barock bis zum Klassizismus für schmückende Elemente an Säulen und für Stuckaturen.

Eine rätselhafte Pflanze in wundersamer Gestalt.
Inhaltsstoffe:
Gerbstoffe, Bitterstoffe, Schleimstoffe, Mineralien
Wirkung:
schmerzstillend, wundheilend, gewebserweichend