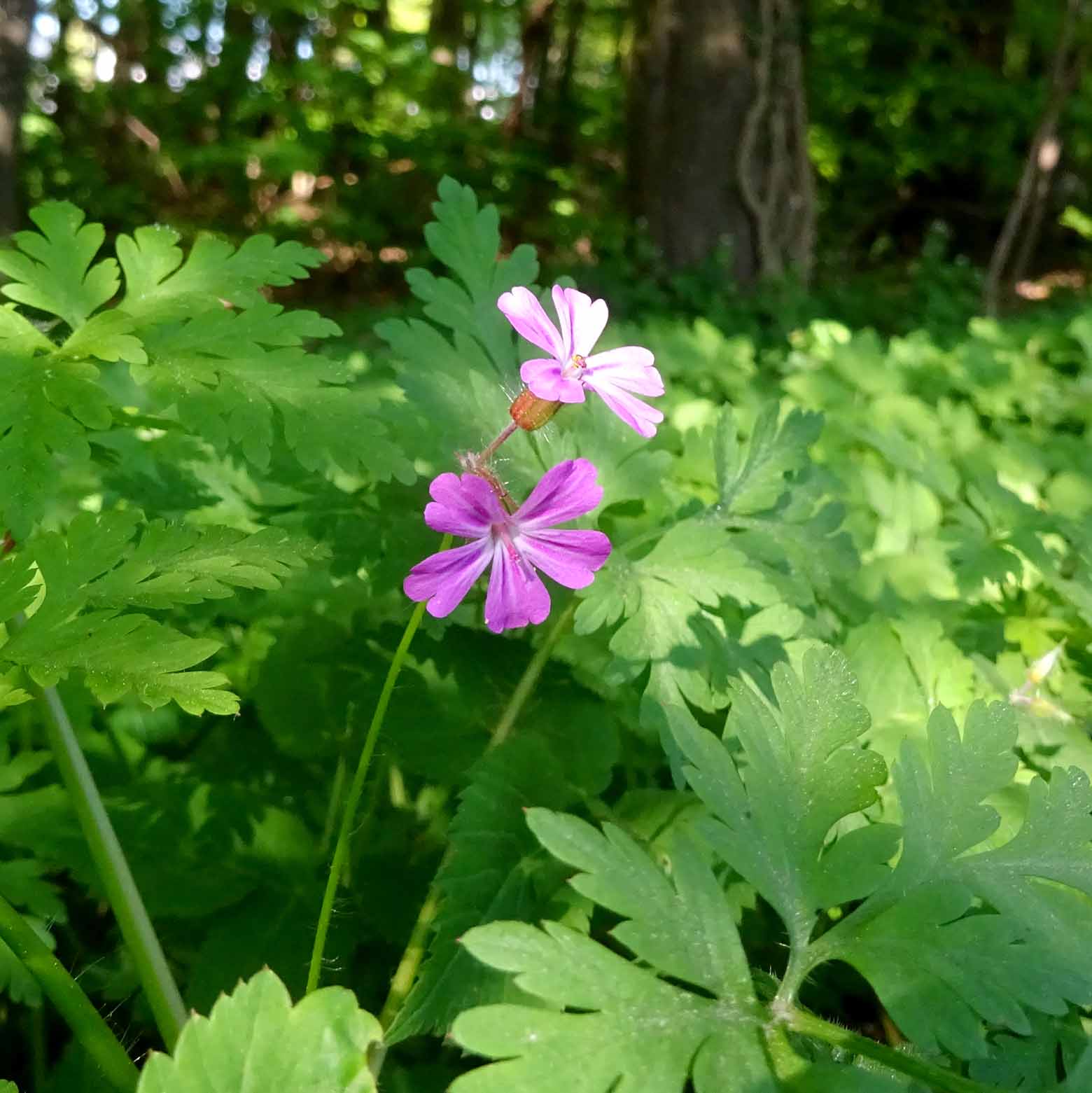Byzantinischer Wollziest – Rabattenschönling mit zweiter Karriere
Byzantinischer Wollziest (Stachys byzantina K.)
Das augenfälligste Merkmal des Wollziest (Stachys byzantina K.) sind seine grau-weisslich stark behaarten Blätter und Stängel. Ihre Form und die wollartige Behaarung haben ihm auch die gefälligen Zweitnamen Eselsohr, Lambs ear, Silver Carpet, Hasenohr oder einfach auch Wolliger Ziest eingebracht. Der Kontrast zwischen dem wolligen Grau und dem tiefen Grün seiner Blätter half dem Wollziest sich im Laufe der Zeit und Moden als Liebling schmückender Rabatten zu etablieren. Sein Erscheinungsbild sticht hervor unter den rund dreihundert Cousins seiner Gattung. Der Gattungsname Stachys leitet sich vom griechischen Wort «stachys (=στα ́χυς)» ab und bezieht sich auf die Art des Blütenstandes, der als „Maisähre“ charakterisiert wird. Der Stachys byzantina schmückt sich mit dezent violetten Blütenmäulchen am aufragenden Blütenstand.

„Die Blüten sind nur ein Schmuck am zur Zierde gereichenden Ganzen.“
Schönling mit Geschichte aber ohne Belege
Zahlreiche Quellen bezeichnen den Stachys byzantina als alte Heilpflanze. Wie so oft fehlen die Belege hierfür. Inzwischen scheinen die Verwendung und mögliche Indikationen in unseren Breiten vollständig vergessen worden zu sein. Hin und wieder finden sich Hinweise auf die Verwendung von Blättern des Stachys byzantina als Verbandsmittel bei frischen und schlecht heilenden Wunden. Angeblich reichen die Berichte darüber bis ins Mittelalter zurück. Im Iran wird hat sich bis heute die traditionelle Verwendung von Stachys byzantina K. zur Versorgung von Schnittwunden oder infizierten Wunden erhalten. Die Blätter werden sowohl im frischen Zustand als abdeckende Verbände oder als Abkochungen zur Behandlung von Wunden eingesetzt.[1]
Den entscheidenden Hinweis lieferte Dr. Antonin Chabert ein französischer Ethnologe in den berühmten Gärten und Museen von Salagon. Er äusserte sich wie folgt: „Dann gibt es auch noch den Wollziest, den man auf Provenzialisch die Hand Gottes nennt.“ Das sind starke Worte für ein Kraut, dessen heilenden Kräfte heute nur noch vom Hören und Sagen bekannt sind. „Man nutzte ihn als Verband bei Verletzungen. Und das half sehr gut!“[2]
Wahrscheinlich wurden die wolligen Blätter des Stachys byzantina K. im Laufe der Geschichte und im Zuge einer sterilen Wundversorgung von textilen Verbänden als Verbandsmaterial abgelöst. So verschwand seine Bedeutung als Heilpflanze. Lediglich seiner Schönheit verdankt er die Verbreitung in den Ziergärten. Keimfrei sind die mit wolligen Fasern überzogenen Blätter der Pflanzen auf keinen Fall. Dennoch scheinen sie Inhaltsstoffe in sich zu bergen, die einer Wundheilung förderlich sind.
„Wenn Du Scharfsicht besitzest, so zeige diese in weiser Beurteilung der Natur!“
Marc Aurel
Screenings, die sich auf die antimikrobielle Aktivität von Heilpflanzen konzentrierten, untersuchten auch die verschiedenen Vertreter der Gattung Stachys. Beim Wollziest (Stachys byzantina K.) verwiesen die Ergebnisse stets auf eine antibakterielle Aktivität gegen grampositive Stämme und eine mäßige gegen gramnegative Stämme.[3] Eine kürzlich veröffentlichte rumänische Studie zeigt gewisse Vorteile von Stachys-byzantina-Extrakten gegenüber den Vergleichsantibiotika Ampicillin und Gentamicin bei den Erregern Staphylococcus aureus und Staphylococcus epdidermis. Beide Bakterienstämme besiedeln die Haut und Schleimhäute und können Wundinfektionen, Abzesse und Sepsis verursachen.[4] Prinzipiell decken sich die Studienergebnisse mit den beschriebenen traditionellen Anwendungen bei der Wundversorgung. Allerdings ist die Studie an dieser Stelle ungenau. Die beiden Vergleichs-Antibiotika werden bei diesen beiden grampositiven Bakterienstämmen nicht angewendet. Vergleichbare Ergebnisse zeigten Stachys-byzantina-Extrakt und das Antibiotikum Gentamicin beim gramnegativen Bakterienstamm Pseudomonas aeruginosa, einem häufig auftretenden Verursacher von Pneumonien, Harnwegs- und Hautinfektionen. Zu betonen ist hierbei: es handelte sich um Laborversuche (in vitro), bei der reine Bakterienkulturen untersucht wurden. Das klingt zunächst hoffnungsvoll, dennoch müssen wir mit erheblichen Unterschieden in den Ergebnissen ausstehender klinischer Studien rechnen. Einen wichtigen Wirkzusammenhang vermuten die Forscher im Vorhandensein von Phenolen und sauerstoffhaltigen Terpenen, da Terpene wie Linalool, Neronidol und Caryophyllenoxid aus ihrer Sicht aktiver sind als Terpenoide wie β-Pinen und β-Caryophyllen-Kohlenwasserstoffe.[5]
Schönsein alleine reicht nicht
In Bezug auf die möglichen pharmakologischen Eigenschaften der Inhaltsstoffe des Stachys byzantina werden weiter eine Vielzahl potenzieller Anwendungsgebiete diskutiert: Alzheimer, Diabetes, Hyperpigmentierung.[6] Aus heutiger Sicht scheint es sehr wahrscheinlich, dass dem Wollziest bald eine dritte Karriere bevorsteht. Das wäre dann immerhin die zweite Karriere als Heilpflanze!

Degradiert als Gartenschmuck ziert die alte Heilpflanze Wollziest die Rabatten.
Grosse Unterschiede fanden die Forscher im Pflanzenmaterial unterschiedlicher Herkunft. Das ist nicht neu. Vor dieser Herausforderung stehen Forscher, Produzenten und Verwender von Heilpflanzen gleichermassen. Der Gehalt und die Zusammensetzung pflanzlicher Inhaltsstoffe sind von Variablen wie Standort, Bodenverhältnisse, Witterungseinflüsse und Faktoren der Abstammung und Vermehrung abhängig. Sie haben einen Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen. Insbesondere Heilpflanzen sind von diesen extrinsischen und intrinsischen Faktoren stark betroffen. Das drückt sich schliesslich in den biochemischen und physiologischen Funktionen ihrer ätherischen Öle aus. Deutlich zeigten sich Unterschiede im Gehalt der Inhaltsstoffe derselben Pflanzenart aus verschiedenen Anbaugebieten (Rumänien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Türkei). Die Schwankungen waren zum Teil so stark, dass Pflanzenproben aus vergleichbaren Anbaugebieten Inhaltsstoffe vermissen liessen.5 Das erklärt allerdings nicht, weshalb in einigen Regionen die Verwendung von Stachys byzantina bis heute fortbesteht und in anderen Regionen aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist.

Inhaltsstoffe:
Apigenin, Apigenin 7-O-β-glucoside, Apigenin 7-(6′′-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside, Apigenin 7-(6′′-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside, Isoscutellarein 7-O-β-D-allopyranosyl-(1→2)-[6′′-O-acetyl]-β-D-glucopyranoside (16), 4′-Methyl-isoscutellarein-7-O-β-D-allopyranosyl-(1→2)-[6′′-O-acetyl]-β-D-glucopyranoside, Verbascoside, 2′-O-Arabinosyl verbascoside , Aeschynanthoside C , Ajugoside, Harpagide, Acetylharpagide, Harpagoside, Catalpol, Aucubin, Stigmasterol, β-Sitosterol, Lawsaritol, Stigmastan-3,5-dien-7-one, Byzantionoside, Icariside B2, Ionol Glucoside, Blumeol C Glucoside
Wirkung:
Antibakteriell, antioxidativ, insektizid
Quellen:
[1] Tomou, E. M., Barda, C., & Skaltsa, H. (2020). Genus Stachys: A Review of Traditional Uses, Phytochemistry and Bioactivity. Medicines (Basel, Switzerland), 7(10), 63. https://doi.org/10.3390/medicines7100063
[2] https://www.arte.tv/de/videos/100113-003-A/provence-magische-kraeuter/; 29.12.2021
[3] Soković, M.; Glamočlija, J.; Marin, P. D.; Brkić, D.; van Griensven, L. J.; Antibacterial effects of the essential oils of commonly consumed medicinal herbs using an in vitro model. Molecules. 2010 Oct 27;15(11):7532-46. doi: 10.3390/molecules15117532. PMID: 21030907; PMCID: PMC6259430.
[4] Psychrembel – Klinisches Wörterbuch: 267. bearbeitete Auflage, de Gruyter, Berlin 2017.
[5] Stegăruș, D. I.; Lengyel, E.; Apostolescu, G. F.; Botoran, O.R .; Tanase, C.; Phytochemical Analysis and Biological Activity of Three Stachys Species (Lamiaceae) from Romania. Plants 2021, 10, 2710. https://doi.org/10.3390/plants10122710
[6] Sarikurkcu, C.; Kocak, M. S. ; Uren, M. C.; Calapoglu, M.; Tepe, A. S.; Potential sources for the management global health problems and oxidative stress: Stachys byzantina and S. iberica subsp. iberica var. densipilosa. Eur. J. Integr. Med. 2016, 8, 631–637.